Das Wichtigste in Kürze
- Die neue Anlage in Brevik fängt jährlich 400.000 Tonnen CO₂ ab.
- Das Projekt ist Teil des Longship-Projekts der norwegischen Regierung.
- Heidelberg Materials plant weitere CCS-Projekte weltweit.
Brevik/Heidelberg. Es ist „nur“ eine neue Anlage in einem Zementwerk von Heidelberg Materials. Und doch kam zur Einweihung dieser Anlage zur Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid (CCS) am Mittwoch viel Prominenz aus Wirtschaft und Politik ins norwegische Brevik. Was hinter dem Projekt steckt:
Was macht diese neue Anlage in Brevik genau?
Es ist die nach Konzernangaben weltweit erste Anlage zur CO₂-Abscheidung und -Speicherung im industriellen Maßstab in der Zementindustrie. Die Anlage wurde im laufenden Betrieb in das Zementwerk eingebaut. Brevik CCS wird rund 400.000 Tonnen CO₂ pro Jahr auffangen. Das entspricht etwa 50 Prozent der Emissionen des Werks. Heidelberg Material hat ausgerechnet, dass das vergleichbar ist mit dem CO₂-Ausstoß pro Passagier von rund 150.000 Hin- und Rückflügen zwischen Frankfurt und New York.
Was bedeutet Carbon Capture and Storage?
Das Kohlendioxid wird bei dem Speicherverfahren Carbon Capture and Storage (CCS) dort aufgefangen, wo es entsteht, also in Brevik bei der Zementherstellung. Anschließend wird es unter der Erde gespeichert. Das Klimakillergas Kohlendioxid kann somit nicht in die Atmosphäre gelangen. Es ist dann zwar nicht weg, verstärkt aber den Treibhauseffekt nicht. Für Industrien wie die Baustoffbranche gibt es bis jetzt schlicht keine technische Lösung, die verhindert, dass CO₂ in der Produktion entsteht. Für sie ist CCS aktuell die zentrale Möglichkeit, ihren hohen Kohlendioxid-Ausstoß entscheidend zu verringern. Unter Umweltschützern gibt es Befürworter, aber auch Gegner von CCS.
Warum wurde das Projekt in Norwegen realisiert?
Die Anlage ist Teil des Longship-Projekts der norwegischen Regierung, das Europas erste vollständige Wertschöpfungskette für die Abscheidung, den Transport und die Speicherung von CO₂ entwickelt hat. Das in Brevik abgeschiedene CO₂ wird verflüssigt und zu einem Onshore-Terminal an der norwegischen Westküste verschifft. Von dort aus wird es per Pipeline in eine Lagerstätte unter der Nordsee transportiert. Früheren Angaben zufolge übernimmt die norwegische Regierung 80 Prozent der Investitionen allein für Brevik, rund 350 Millionen Euro. Insgesamt sind es 1,4 Milliarden Euro.
Wieso wird das CCS-Projekt so euphorisch gefeiert?
„Der heutige Tag ist ein historischer Meilenstein und eine tektonische Verschiebung in der Welt des Bauens“, sagte Dominik von Achten, Vorstandschef von Heidelberg Materials. Für diesen „Meilenstein“ hat der norwegische Kronprinz Hakoon sogar eine Gedenktafel aus Beton enthüllt. Die Zementindustrie zählt bislang zu den Industrien, die weltweit am meisten Kohlendioxid emittieren. Sie wird für sieben Prozent des globalen CO₂-Ausstoßes verantwortlich gemacht. Wird die CCS-Technologie tatsächlich einmal ausgerollt auf viele Werke, würde die Zementherstellung deutlich weniger klimaschädlich. Mit der Anlage in Brevik, die nach Konzernangaben schon erfolgreich angelaufen ist, beweist einer der größten Zementhersteller, dass die Technik auch im industriellen Maßstab angewandt werden kann.
Was bringt Brevik CCS dem Konzern wirtschaftlich?
Es ermöglicht Heidelberg Materials, den weltweit ersten Net-Zero-Beton zu vermarkten. Das Unternehmen sieht dabei einen Entwicklungsvorsprung von mehreren Jahren gegenüber der Konkurrenz. Der Zement aus Brevik mit seinem geringeren CO₂-Fußabdruck wird über komplizierte Berechnungen und Zertifizierungen dabei eingerechnet. Jetzt soll die Auslieferung an erste Kunden starten, die bereit sind, für nachhaltige Bauprojekte auch einen höheren Beton-Preis zu zahlen. Zum Beispiel soll das neue Nobel-Center in Stockholm mit dem klimaneutralen Baustoff errichtet werden. Allerdings wird er zuerst nicht einmal ein Prozent des weltweiten Absatzes der klimaneutrale Baustoff ausmachen.
Wie geht es weiter nach dieser Pilotanlage?
Die Erfahrungen in Brevik als „wichtige Blaupause“ will Heidelberg Materials für weitere weltweite CCS-Projekte nutzen. Bereits angestoßen hat der Konzern nach eigenen Angaben bereits etwa ein Dutzend CCUS-Projekte, darunter die Werke in Edmonton/Kanada, Padeswood/Großbritannien und Mitchell/USA. Allerdings könnte sich das Tempo des Konzerns bei der Dekarbonisierung verlangsamen. So hat sich US-Präsident Donald Trump komplett von der Klimapolitik abgewandt, und die EU will ihre ehrgeizigen Klimaziele jetzt doch industriefreundlicher gestalten. Die CCS-Technologie erfordert hohe Investitionen – Unternehmen wie Heidelberg Materials betonen, dass Projekte wie Brevik nur mit öffentlichen Fördergeldern möglich sind.
Wie stehen jetzt die Chancen für das US-Werk nach Trumps Kursänderung?
Für das CCS-Großprojekt im Zementwerk Mitchell waren von der Vorgänger-Regierung um Ex-Präsident Joe Biden hohe Fördergelder zugesagt worden. Jetzt allerdings sieht es düster aus für die Pläne. Ein Heidelberg-Materials-Sprecher teilte auf Anfrage mit: „Wir wurden darüber informiert, dass die Förderung in Höhe von 500 Millionen US-Dollar durch das US-Energieministerium (DOE) für unser Projekt zur Dekarbonisierung des Mitchell-Zementwerks in Indiana eingestellt wird.“ Gegen diese Entscheidung könne Berufung eingelegt werden. „Wir prüfen derzeit diese Möglichkeit und evaluieren die nächsten Schritte für das Mitchell-Projekt“, so der Sprecher.
Und was ist mit Deutschland, gibt es da auch Projekte?
Im nordreinwestfälischen Werk Geseke von Heidelberg Materials wird eine großtechnische CO₂-Abscheidung sowie eine Lösung für Transport und Speicherung realisiert. Das Vorhaben setzt auf eine andere Technologie als in Brevik, auf die Oxyfuel-Technologie. Ziel ist 700.000 Tonnen CO₂ pro Jahr abzuscheiden und zu speichern. Die Gesamtinvestition beträgt nach Konzernangaben mehr als eine halbe Milliarde Euro und wird mit rund 191 Millionen Euro aus dem EU-Innovationsfonds gefördert. „Wir arbeiten derzeit mit Hochdruck daran, den Baustart vorzubereiten“, sagt der Konzernsprecher.
Hier ist die Speicherung von Kohlendioxid noch gar nicht erlaubt. Wie soll das funktionieren?
Die deutsche Industrie setzt darauf, dass die neue Bundesregierung ein Gesetzesvorhaben des früheren grünen Wirtschaftsministers Robert Habeck zügig umsetzt. Dieses soll Unternehmen auch in Deutschland erlauben, ihre CO₂-Emissionen abzuscheiden und zu speichern – voraussichtlich auch in der Nordsee. Nach Informationen des „Handelsblatt“ ist bereits ein Abschluss des geplanten Gesetzes für Oktober 2025 angepeilt.
Wie sieht es in der Metropolregion Rhein-Neckar aus?
Auch hier gibt es CO₂-intensive Produktion, wie etwa bei der BASF in Ludwigshafen. Die Metropolregion Rhein-Neckar hat den Aufbau einer CCS-Infrastruktur in der Region als Teil ihrer neuen Strategie ausgerufen. Dafür sollen zuerst einmal die potenziell zu transportierenden Mengen und Ströme in der Region erfasst werden. Ziel ist dann ein Anschluss der Metropolregion an ein deutsches CO₂-Pipeline-Netz, bei dem Emissionen gesammelt und dann zu Lagerstätten in der Nordsee transportiert werden.
URL dieses Artikels:
https://www.bergstraesser-anzeiger.de/wirtschaft/firmen_artikel,-heidelbergcement-warum-heidelberg-materials-die-neue-anlage-in-brevik-mit-einem-prinzen-feiert-_arid,2311230.html
Links in diesem Artikel:
[1] https://www.mannheimer-morgen.dehttps://www.mannheimer-morgen.de/wirtschaft_artikel,-regionale-wirtschaft-wie-heidelberg-materials-das-klimakiller-gas-co2-einfangen-will-_arid,2236608.html
[2] https://www.mannheimer-morgen.dehttps://www.mannheimer-morgen.de/wirtschaft_artikel,-regionale-wirtschaft-so-wird-bald-kohlendioxid-in-der-nordsee-gespeichert-_arid,2236615.html
[3] https://www.mannheimer-morgen.dehttps://www.mannheimer-morgen.de/wirtschaft/firmen_artikel,-heidelbergcement-heidelberg-materials-haelt-trotz-trump-an-co2-zielen-fest-_arid,2287962.html
[4] https://www.mannheimer-morgen.dehttps://www.mannheimer-morgen.de/wirtschaft/firmen_artikel,-heidelbergcement-heidelberg-materials-setzt-auf-betonrecycling-_arid,2308877.html
[5] https://www.mannheimer-morgen.dehttps://www.mannheimer-morgen.de/wirtschaft_artikel,-regionale-wirtschaft-wie-will-die-metropolregion-die-energiewende-bewaeltigen-_arid,2306245.html
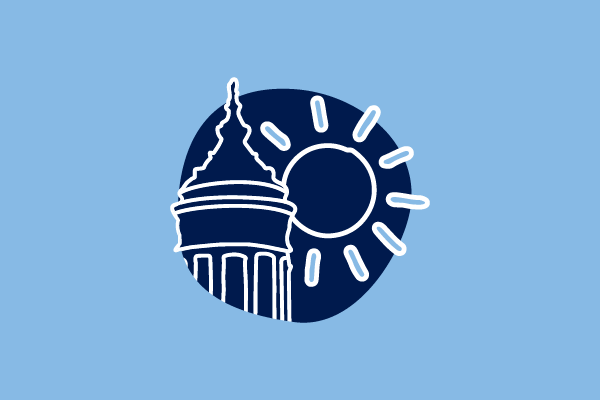
Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Kommentar Hoffnung für eine klimafreundlichere Zementbranche