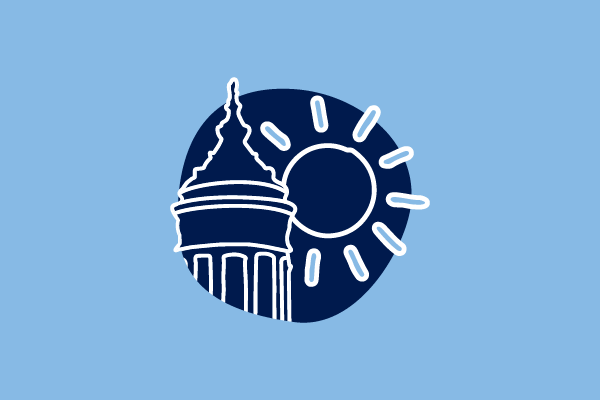Schon vor dem Eingang steht ein Rest der Berliner Mauer, ein Original vom Potsdamer Platz. Dort ist auch ein Grenzsoldat postiert, aus Bronze, der Blick starr nicht in Richtung der Mauer gerichtet, sondern ins eigene Land. Manche Besucher, vor allem Schüler, kommen da ins Grübeln. Wenn der „Antifaschistische Schutzwall“, wie die DDR ihre hermetisch gesicherte Grenze genannt hat, doch gegen Angriffe des Westens gerichtet sein sollte – warum schaut der Wachsoldat dann nicht zum vermeintlichen Feind, sondern hält die eigene Bevölkerung im Auge?
„Wir haben das bewusst so aufgebaut, um zum Nachdenken anzuregen“, sagt Moritz Bach, der Leiter des DDR-Museums. „Tatsächlich merken viele: Da kann etwas nicht stimmen“, berichtet er. Und so ist das ganze Museum darauf ausgerichtet, Denkanstöße zu geben und besonders die dunklen Seiten der Diktatur wie Mangelwirtschaft und Bespitzelung zu thematisieren. Bewusst definiert sich das Museum als Lernort der Demokratie, um zu zeigen, dass Freiheit und Rechtsstaatlichkeit keineswegs selbstverständlich sind, sondern für DDR-Bürger hart erkämpft werden mussten. Das Motto lautet „Gegen das Vergessen“.
Formuliert hat es Klaus Knabe. Dem gebürtigen Sachsen war noch drei Wochen vor dem Mauerbau 1961 die Flucht aus der DDR in den Westen gelungen, nachdem er als gläubiger Christ Repressionen des Staatssicherheitsdienstes (Stasi) ausgesetzt war. Als die DDR 1989 am Ende ist, die Mauer fällt und die Wiedervereinigung kommt, fängt er an, Dinge aus der DDR zu sammeln – zunächst privat. „Er wollte, dass die Erinnerung nicht verloren geht, die Geschichte nicht verklärt, die DDR nicht rückblickend beschönigt wird“, erläutert der Museumsleiter.
„Geschichte erklären, nicht verklären“
Doch zunächst sei das nur eine, wie er formuliert, „Chaossammlung“ auf dem Dachboden bei Knabe gewesen. Als die immer mehr wächst, stellt ihm die Stadt Pforzheim Räume zur Verfügung: den Kindergarten der Kaserne des 1996 abgezogenen Husaren-Regiments der französischen Armee. 1998 entsteht hier dann, wie Bach hervorhebt, allein durch ehrenamtliche Arbeit von Klaus Knabe und einigen Helfern, meist ebenso aus der DDR geflüchtet, „das einzige DDR-Museum in Westdeutschland“.
2003 übernimmt ein Verein die Trägerschaft, zeitweise geleitet vom späteren Bundespräsidenten Joachim Gauck. „Eine Demokratie ist nicht einfach da, und – vor allem – sie bleibt nicht von allein“, begründet er, warum solch ein Museum nötig ist. Seit Knabes Tod 2012 trägt es eine von Land und Stadt unterstützte Stiftung. Sie wolle, so sagt es Moritz Bach, „Geschichte erklären, nicht verklären“ und anhand von Originalexponaten vermitteln, wie es aussah in dem ja nun auch schon über 30 Jahre nicht mehr existierenden „Arbeiter- und Bauernstaat“.
Wer Mauerstück und Bronze-Grenzsoldat passiert hat, dessen Blick fällt am Eingang auf einen Pfahl der einstigen Grenzmarkierung, Schwarz-Rot-Gold angestrichen, wenn auch schon sehr abgebröckelt, und mit dem Wappen der DDR, dem Ährenkranz, der Hammer und Zirkel umgibt. Aber nicht nur der Grenzpfahl bröckelt, auch das Regime. Ein großes, eine ganze Wand füllendes Foto der Demonstration vom 9. Oktober 1989 in Leipzig zeigt gleich am Eingang, wann das Ende des Regimes eingeleitet wird – laut Moritz Bach an diesem Tag, als die Rufe „Wir sind das Volk“ durch die Straßen schallen. „Die Staatsmacht schreckt vor Gewaltanwendung gegen das eigene Volks zurück, und damit ist der Weg zur Wiedervereinigung geöffnet“, sagt er zu dem Foto.
Aber was die DDR bis zur Wiedervereinigung ausmacht, zeigen dann acht Räume und der Keller – mit vielen Exponaten, Dokumenten, Zeitzeugenerinnerungen. Und natürlich dürfen manche im Westen mit der DDR in Verbindung gebrachte Kuriosa wie das Sandmännchen und die Ampelmännchen nicht fehlen, aber ebenso Braunkohlebriketts und zwei Einmachgläser mit „Geruchsproben“. Die hat sich die Staatssicherheit heimlich von Regimegegnern beschafft und für Fahndungsmaßnahmen per Suchhund aufbewahrt. Der Museumsleiter zählt sie zu den „Highlightexponaten“.
Über allem steht das riesige Emblem eines Händedrucks. Jener Handschlag vom 21. April 1946, als unter dem Druck der sowjetischen Besatzungsmacht die Vorsitzenden von SPD und KPD in der damaligen Ostzone, Otto Grotewohl und Wilhelm Pieck, die Vereinigung zur „Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands“ (SED) inszenieren. Die zwei Hände werden zum Symbol der SED-Herrschaft in der DDR. „Die Partei beherrschte Staat und Gesellschaft“, so Museumsleiter Bach.
Er kann das an einer eindrucksvollen Vitrine demonstrieren. Sieben Reihen, jeweils etwa 1,50 Meter lang, zeigen einen Ausschnitt von Orden und Ehrenzeichen und damit ihren weitreichenden Einfluss in alle Lebensbereiche. „Die Partei hatte überall die Finger drin“, so Moritz. 40 000 solcher Orden und Abzeichen für allerlei tatsächliche oder vermeintliche Verdienste seien bis zum Ende der DDR ausgegeben worden, von Parteien und kadermäßig aufgebauten Massenorganisationen.
Stempel, Parteiabzeichen, Fahnen, Parteibücher – was Knabe gesammelt hat, wird nur auszugsweise gezeigt, aber es illustriert eindrücklich den weitreichenden Einfluss der SED. Andere Parteien gibt es zwar, aber in der „Nationalen Front“ der SED untergeordnet, und bei Wahlen fehlt die Auswahl. „Zettel falten“ haben die DDR-Bürger das daher genannt. Und auch wenn 39 Tageszeitungen theoretisch eine Meinungsvielfalt darstellen – Themen, ja Formulierungen und Überschriften richten sich nach dem Leitorgan, dem SED-Parteiblatt „Neues Deutschland“.
Und wehe, es will jemand den Vorgaben nicht folgen: Dagegen gibt es das Ministerium für Staatssicherheit (MfS), im Volksmund „Stasi“. „Das einzige Ministerium, das über all die Jahre gewachsen ist, auf 90 000 Mitarbeiter bis 1989 – ohne die inoffiziellen Mitarbeiter“, sagt Bach. Sprich: Ohne die Spitzel. Die Richtlinie „1/79“, gekennzeichnet als „Geheime Verschlusssache“, über den Umgang mit und die Anwerbung solcher „Inoffiziellen Mitarbeiter“ (IM) ist zu sehen und so erschreckend wie viele weitere Details des Zwangsapparats des MfS.
Es hat sich als „Schwert und Schild der Partei“ verstanden, mit dem Ziel einer Verhinderung jeglicher Opposition. „Bespitzelung und Zersetzung gingen bis ins Privatleben, daran sind viele Familien zerbrochen“, weiß der Museumsleiter: „Über jeden zweiten Einwohner der DDR wurde eine Stasi-Akte geführt.“
Den Volksaufstand in der DDR am 17. Juni 1953 thematisiert das Museum ebenso wie den Mauerbau am 13. August 1961– und stellt stets auch die DDR-Lesart vor. So heißt es noch 1989 in einem DDR-Geschichtsbuch, der „faschistische Putschversuch“ 1953 sei gescheitert, weil Mitglieder der SED-Jugendorganisation auf Fahrrädern ausgerückt seien – von den sowjetischen Panzern, die den Aufstand niedergemalmt haben, ist nicht die Rede. Und die Mauer wird als „Antifaschistischer Schutzwall“ verklärt. 138 Menschen sind hier mindestens gestorben, nur weil sie in Berlin vom Osten in den Westen wollen.
Selbstschussanlagen und Schießbefehl
Eine 43 Kilometer lange Betonmauer trennt 28 Jahre Ost-Berlin vom Westen, weitere 111 Kilometer Sperranlagen grenzen die Berliner Westsektoren zur DDR ab. Und 1378 Kilometer lang zieht sich die Grenze quer durch Deutschland – mit Metallgitterzäunen, Kfz-Sperrgraben, Stolperdrähten, Spurensicherungsstreifen, Hundelaufanlagen, Wachtürmen, Erdbunkern, Minen. Und da liegen sie dann in der Vitrine, die Minen, die so verlegt worden sind, dass sie auf der DDR-Seite der Grenze explodieren, und die Selbstschussanlagen, die mit 80 kantigen Metallteilen Menschen im Umkreis von 120 Metern schwer verletzen – alles gegen eigene Bürger gerichtet, nicht den „Klassenfeind“. 55 000 dieser Selbstschussanlagen (Typ SM 70) hat es ab 1970 gegeben.
Nicht nur sie sind tödlich. Es gibt ja noch den Schießbefehl, im Original zu sehen und nachzulesen. „Zögern Sie nicht mit der Anwendung der Schusswaffe, auch dann nicht, wenn die Grenzdurchbrüche mit Frauen und Kindern erfolgen, was sich die Verräter schon oft zunutze gemacht haben“, heißt es in der Dienstanweisung, im Original in der Stasi-Unterlagenbehörde archiviert und hier als Kopie ausgestellt; dazu die passenden AK 47-Maschinenpistolen („Kalaschnikow“) und die Dienstgradabzeichen der Soldaten, nachempfunden der Wehrmacht.
Die ganze Gesellschaft wird früh militarisiert. Weitwurf mit Plastikhandgranaten im Sportunterricht und im Mathematikbuch der zweiten Klasse Rechenaufgaben anhand von einer Artilleriestellung und der dafür benötigten Kanoniere der Nationalen Volksarmee (NVA) belegen dies. Moritz Bach zeigt sogar auf ein Bild aus einer Krippe zu DDR-Zeiten. „Der gemeinsame Gang aufs Töpfchen war üblich und wichtig für das sozialistische Gemeinschaftsgefühl“, sagt er. Denn Individuen gelten nichts, von den „Jungen Pionieren“ bis zu den „Blauhemden“ der Freien Deutschen Jugend (FDJ) werden Kinder und Jugendliche früh und straff daran ausgerichtet, dass nur das Kollektiv zählt.
„Ja, natürlich gab es viele Jugendclubs, bessere Kinderbetreuung, aber ausgerichtet am ideologischen Ziel der SED und weil die Frauen als Arbeitskraft wichtig waren“, betont der Museumsleiter. Aber da die Partei- und Staatsführung weiß, wie groß der West-Einfluss ist, schreibt sie immerhin fest, dass die DJs in Jugendclubs höchstens 60 Prozent West-Titel spielen dürfen, 40 Prozent müssen von DDR-Musikgruppen sein. „Die Listen, was gespielt wird, waren bei staatlichen Stellen einzureichen“, so Bach. Wer westliche Bluejeans, Beatlesfrisur oder Schlaghosen trägt, gilt als „westlich dekadent“ oder „feindlich-negativ“.
Und doch hat man ihn gebraucht, den Westen. Das Museum zeigt dies anhand der Mangelwirtschaft, weshalb Schlangestehen und Versorgungsengpässe Alltag in der DDR sind. Nicht nur auf einen „Trabi“, den berühmten Zweitakter, müssen DDR-Bürger oft ewig warten. „Bei der Geburt bestellt, zum Führerschein da“, scherzt Bach. Lange stabilisieren 25 Millionen Pakete aus dem Westen an Freunde und Verwandte in der DDR die Versorgungslage. Wenn DDR-Bürger sich revanchieren wollen, können sie höchstens Schnitzereien aus dem Erzgebirge, Schallplatten vom Thomanerchor oder Meißner Porzellan zu den Westverwandten schicken. Dass in einer Vitrine dann ein Werbetransparent „Konsum im Dienste der Werktätigen – leistungsstark, modern und effektiv“ hängt, lässt einen dann doch schmunzeln.
Am Ende kann sich das Regime nicht halten
Weniger amüsant ist, wie sehr sich das Regime mit Zahlungen aus dem Westen stabilisiert hat. 3,3 Milliarden D-Mark erwirtschaftet es durch für bundesrepublikanische Firmen (teils sogar von Häftlingen) hergestellte Artikel oder die Geschenkdienst- und Kleinexporte GmbH (Genex), über die Bundesbürger aus Katalogen Geschenke bestellen und mit D-Mark bezahlen können, die dann an Verwandte und Bekannte in der DDR gehen. Gar 3,51 Milliarden D-Mark nimmt die DDR ein, weil die Bundesrepublik zwischen 1963 und 1989 über 30 000 politische Gefangene freikauft.
Deren Leiden lassen sich im Keller nachvollziehen, wo eine Original-Zelle und ein Verhörraum der Stasi nachgebaut sind, zudem mehrere Zellentüren verschiedener Haftanstalten. „Wenn uns ehemalige Häftlinge besuchen, dann erkennen sie oft die Türen wieder“, sagt Bach. Es ist ein sehr beklemmendes Kapitel in diesem Museum.
Aber 1989 ist Schluss, da wirken der Druck der Stasi, die staatliche Gewaltandrohung nicht mehr. Noch am 14. August 1989, knapp drei Monate vor dem Mauerfall, äußert sich DDR-Staats- und Parteichef Erich Honecker fest vom Sieg der DDR überzeugt. „Den Sozialismus in seinem Lauf, halten weder Ochs noch Esel auf“, sagt er in Erfurt. Bei der Feier zum 40. Jahrestag der DDR ermahnt der sowjetische Generalsekretär Michail Gorbatschow Honecker zwar zu Reformen, aber der stellt sich stur. Doch Friedensgebete, Proteste und Demonstrationen weiten sich immer mehr aus. Das letzte, wieder eine Wand füllende Foto im Museum trägt die Überschrift „Wir sind ein Volk“ und zeigt das geöffnete Brandenburger Tor. Und in einer Vitrine liegt das Fragment eines völlig kaputten, zerbröselten DDR-Grenzpfahls. Der Museumsgründer selbst hat ihn im Bereich zwischen Thüringen und Bayern, wo er einfach so auf dem Boden lag, aufgehoben und mitgenommen.
URL dieses Artikels:
https://www.bergstraesser-anzeiger.de/leben/erleben_artikel,-erleben-der-unterdrueckerstaat-ddr-wurde-vor-75-jahren-gegruendet-_arid,2248491.html